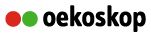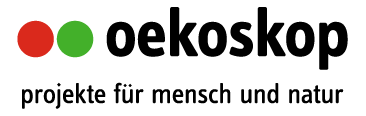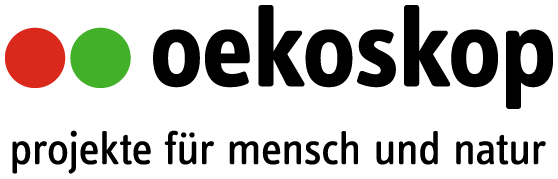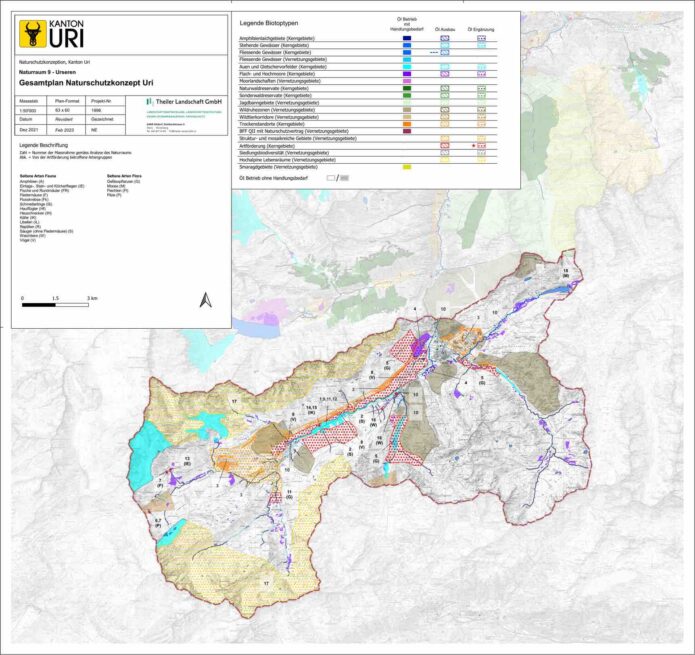In den beiden Ortschaften Lantsch/Lenz sowie Brienz/Brinzauls im Albulatal (Kanton GR) finden sich im Landwirtschaftsgebiet zwei traditionelle Heckenlandschaften. Wiesen, Weiden und Ackerflächen wechseln sich ab mit zahlreichen Hecken und weiteren Strukturelementen wie Trockensteinmauern und Steinwällen. Solch kleinstrukturierten Gebiete sind heute nur noch selten zu finden.
Einzelne landwirtschaftliche Betriebe weisen besonders viele Hecken auf ihrem Betrieb auf. Wegen den generell abnehmenden Arbeitskapazitäten in der Landwirtschaft konnten viele Hecken in den letzten Jahren nicht mehr gepflegt werden. Wenn eine regelmässige Pflege der Gehölze ausbleibt, nimmt die schnellwüchsige Hasel überhand. Die Vielfalt an Gehölzen nimmt ab – und damit verschwinden auch anspruchsvolle Tierarten wie der Neuntöter.
In den beiden Heckenlandschaften wurde deshalb ein Projekt gestartet, welches die Landwirte bei einer zeitlich befristeten Aufwertung der Hecken unterstützt. Das Ziel ist es, die Haseln so weit zurückzudrängen, dass sie substanziell reduziert werden und anschliessend durch die Landwirte selbst in Schach gehalten werden können.
Im Projekt wird der Pflegebedarf der Hecken ermittelt und es werden verschiedene Pflegeeinsätze durchgeführt. Das Projekt soll zudem Erkenntnisse zur Bekämpfung der Haseln und der notwendigen Nachpflege liefern.
In einem Anschlussprojekt werden zusätzlich Habitatbäume in den Hecken erfasst und es wird erprobt, wie solche Habitatbäume wirkungsvoll geschützt werden können.
oekoskop hat gemeinsam mit dem Verein Park Ela sowie dem kantonalen Amt für Natur und Umwelt das Projekt entwickelt und nimmt die Projektleitung wahr.
Auftraggeber: Verein Parc Ela
Projektleitung: Regina Jöhl, Monika Martin, Mitarbeit: Elisabeth Kühn, Barbara Huber, Gianna Könz