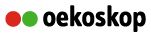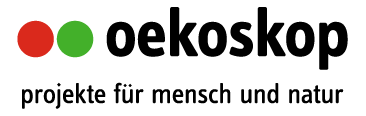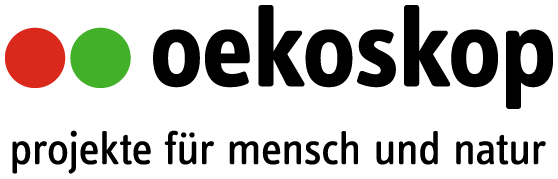70% der Schweizer Bevölkerung leben in Agglomerationsräumen, in welchen ab den 1950er Jahren oftmals planlos neue Wohn- und Gewerbezonen durcheinander gewürfelt wurden. Nahe gelegene und qualitativ befriedigende Grün- und Freiräumen für Begegnung, Spiel, Sport und Naturerfahrung werden immer wichtiger. Gleichzeitig wird es immer dringender, die Ansprüche der verschiedenen Nutzer zu koordinieren und Antworten auf neue Trends zu finden.
oekoskop erstellt regelmässig Fachanalysen zur bestehenden Grün- und Freiraumsituation in Siedlungen. Auch entwickeln und begleiten wir massgeschneiderte Aufwertungs- und Belebungsmassnahmen zusammen mit der betroffenen Bevölkerung:
Beispiele:
Grün-und Freiraumstrategie Lange Heid, Münchenstein: Wir bereiteten die Empfehlungen von drei unterschiedlichen Landschaftsarchitekturbüros, welche während eines Kurzworkshops zur Aufwertung eines Agglomerationsquartiers skizziert wurden, zu einem richtungsweisenden Strategiepapier der Quartierentwicklung auf.
„Wildtierkorridor“ für Menschen: Für die Verbindung zwischen dem Dreispitzareal und dem südlich angrenzenden Wohnquartier entwarfen wir in Analogie zu Wildtierkorridoren eine parkartig nutzbare Überführung.
Umnutzung für kollektiven Mehrwert: Ebenfalls zum klassischen Repertoire im Bereich Landschaftsarchitektur gehörte eine Konzeptskizze in Varianten zur sukzessiven Umnutzung eines Familiengartenareals für einige Wenige hin zu einem von der Allgemeinheit nutzbaren multifunktionalen Begegnungs- und Betätigungsraum.
Interkultureller Quartiergarten: Im Zusammenhang mit der Quartierentwicklung Lange Heid in Münchenstein konzipierte und initiierte oekoskop einen interkulturellen Quartiergarten als biologische Permakultur. Der Garten wurde in das Programm „nachhaltige Ernährung“ des Bundesamtes für Raumentwicklung aufgenommen (2017), steht im Austausch mit der Organisation „Pro Specie rara“ und erhielt finanzielle Unterstützung durch die Fachstelle Integration BL. Das grosse Interesse am Gartenprojekt führte dazu, dass auch ein naturpädagogisches Freizeitangebot im Quartiergarten für Kinder und ein Modul „Urban gardening“ für die gesamte Schule nebenan aufgegleist wurden.
Kindgerechte Verbesserung des Wohnumfelds: Die aktive Raumaneignung ist wichtig für die Identifikation mit dem Raum und die Erholung. Zusammen mit dem Kinderbüro Basel begleiteten wir Primarschüler durch das Quartier Lange Heid und liessen sie Defizite und „Points of Interest“ bei den vorhandenen Freiräumen definieren. Diese Ergebnisse sowie die Erkenntnisse einer früheren Fachanalyse von oekoskop zu „bewegungsfördernden Wohnumfeldern“ (siehe Link) flossen in kindgerechte Verbesserungen des Wohnumfelds ein.
Weitere Infos:
Studie Bewegungsförderung für den Kanton Baselland
Grün- und Freiraumanalyse Lange Heid
Rechenschaftsbericht Quartiergarten Lange Heid (ARE)